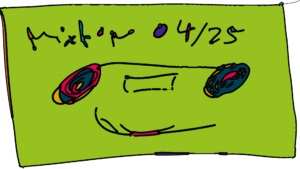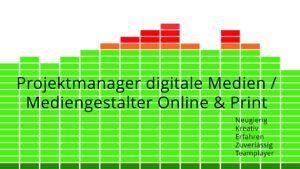Bewerbungsschreiben sind eine seltsame Angelegenheit. Sie ähneln höflichen Erpresserbriefen: „Sehr geehrte Damen und Herren, bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Ich bin unglaublich kompetent und werde es Ihnen beweisen, wenn Sie mich bitte zügig aus meiner finanziellen Misere befreien.“
Wer eine Bewerbung verfasst, jongliert mit Phrasen, die im normalen Sprachgebrauch nie vorkommen. „Ich bringe eine Hands-on-Mentalität mit“ – als ob es Bewerber gäbe, die lieber eine „Hands-off-Mentalität“ anpreisen würden. „Ich bin kommunikativ und teamfähig“ – also weder menschenscheu noch auf Krawall gebürstet.
Gleichzeitig klingen die Stellenanzeigen oft, als hätte ChatGPT einen besonders schlechten Tag gehabt. „Wir sind ein dynamisches Unternehmen mit flachen Hierarchien und suchen motivierte Menschen, die Lust haben, mit uns gemeinsam zu wachsen.“ Bedeutet in Klartext: „Wir zahlen nicht viel, aber dafür dürfen Sie so tun, als wären Sie Ihr eigener Chef.“
Und dann kommt die Frage aller Fragen: Soll man ehrlich sein? Oder muss man sich weiter in der absurden Kunst üben, in 300 Wörtern „Ich kann was, bin aber nicht verzweifelt“ zu sagen? Werden die Anschreiben überhaupt gelesen? Was wird erwartet? Ich erfahre bei Absagen ja nie, was der Personalfachkraft nicht gefallen hat? Soll ich im Detail auf den Inhalte der Anzeige eingehen oder mehr über meine Kompetenzen erzählen? Oder ein Mix aus beidem?
Vielleicht ist es an der Zeit, die Regeln dieses Spiels zu hinterfragen. Oder zumindest eine neue Gattung einzuführen: die ehrliche Bewerbung. Und die ehrliche Absage (wobei eine Zusage natülich besser wäre).
Die Jobsuche geht also weiter. Es bleibt spannend.